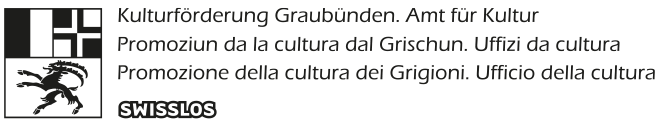Konzert 4
Poesie ↑
Wenn etwas für Cello solo komponiert wird, ist der Bezugspunkt sofort gegeben: Bachs Cellosuiten. Zumindest äusserlich bezieht sich auch Magnus Lindberg in seiner «Partia» von 2001 auf den Thomaskantor. Der Titel hat seinen Ursprung im Originalmanuskript der Violinpartiten – die alte italienische Bezeichnung «partia». Damit jedoch endet schon der Bezug. Die Titel der sechs Sätze sind vielmehr einer vorbachschen Epoche entlehnt, wie Lindberg schreibt: «Nur die Texturen der verschiedenen Sätze erinnern in gewisser Hinsicht an ihre Vorläufer [aus der barocken Suite], die oft eine Allemande, eine Courante und Sarabande, ein Menuett oder eine Bourrée und eine Gigue umfassten. Da mir die Bezeichnung ‹Allemande› nicht gefiel, beginnt meine Suite mit einer ‹Sinfonia› – der Satz, der an ein Karussell gemahnt, ist von der Form her am komplexesten und stellt das Material des Werks vor. Die folgenden fünf Sätze filtern nach und nach das Material und erkunden unterschiedliche Texturen. Der zweite heisst ‹Coranto› und der dritte – ein langsames, sangliches Stück – ‹Aria›. ‹Boria› gleicht einem Scherzo und ein wildes, von der Textur bestimmtes Stück. Das ‹Double› verweist auf das Double-Menuett des Barock; ihm folgt ohne Unterbrechung die ‹Giga› als Finale.»
Dieter Ammanns «Piece for Cello», 1994 komponiert und fünf Jahre danach überarbeitet, trägt den bedenkenswerten Untertitel «imagination against numbers». Die Einbildungskraft wird der Zahl entgegengesetzt. Der Komponist arbeitete nicht nach einem fixen Schema und verzichtete bewusst darauf, das Klangmaterial rhythmisch zu präterminieren, während die Tonhöhen einem rigorosen Konzept folgen. Das ergibt eine Doppelbödigkeit. Zunächst wirkt das Stück äusserst klar. Und bietet dem Ohr Gelegenheit sich einzufühlen, etwa dem umkreisten Zentralton a. Auf einmal schiesst sich das Cello auf einen anderen Zentralton ein, lässt den freien, experimentellen Gestus hinter sich und übernimmt einen fast romantischen Tonfall. War das nicht ein Zitat? fragt man sich. Eine «Quasi Cadenza» fordert die Virtuosität hervor, Ammann treibt sie jedoch ins Ironische. So energiereich und direkt seine Musik wirkt, so enthält sie doch Reflexionen über Musikgeschichte, ja über Gesellschaftliches.
Die Sonate, komponiert von Benedikt bzw. Benedetg Dolf im Sommer 1951, leitet vom Cellosolo zum Lied hinüber. Dolf war und ist wenig bekannt ausserhalb Graubündens, war aber eine äusserst eigenständige und produktive Musikerpersönlichkeit. Zum Glück fand er einzelne einflussreiche Förderer. Seine Kammermusik klingt markig und bestimmt; alle Klangspielereien werden beiseitegelassen; die Energie ist zielgerichtet und führt das Ohr; Bach ist in dieser Sonate durchaus präsent, aber eher im fast durchwegs zweistimmigen Kontrapunkt, als im Tonfall. Da gibt es keine Anleihen. Im Zentrum von Dolfs Schaffen steht jedoch die Vokalmusik, häufig für Chöre, aber auch Klavierlieder. Der Sohn des Dichters und Liedersammlers Tumasch Dolf hat dabei auch zahlreiche rätoromanische Gedichte vertont, einfach und klar, aber unmittelbar in der Wirkung, von denen hier drei zu hören sind: Zwischen Morgen und Abend scheint das neue Leben auf.
Auch der Berner Jürg Wyttenbach hat sich mit romanischen Volksliedern beschäftigt, so schon als Siebzehnjähriger etwa in einer Klaviersonatine. Man stellt ihn sich in den Winterferien in Arosa vor. Das Jugendwerk fehlte lange in seinem Verzeichnis, aber Wyttenbach erinnerte sich später daran und revidierte es im Juli 2001 bei einem neuerlichen Besuch im Bündnerland, dieses Mal beim Festival «Young Artists in Concert» in Davos, bei dem er auf Einladung von Thomas Demenga als «Composer in Residence» mitwirkte. Ein Osterhymnus steht neben einem Scherzino-Rondino. Die Auseinandersetzung mit Volksmusik hatte da längst wieder eingesetzt. Wyttenbach, ein Schulfreund übrigens von Mani Matter, liebte stets das Chanson und das vertrackt einfache Liedchen. In seinem Musiktheaterstück «Gargantua chez les Helvétes du Haut-Valais – oder: ‹Was sind das für Sitten!?›» hat er ein Stück der neuen Schweizer Volksmusik geschaffen, in dem die Walliser Älpler dem urfranzösischen Riesen Gargantua begegnen. Er liebt das Urtümliche. Zehn Jahr nach Davos kam er nochmals auf «romanisch Bünden» zurück und schrieb drei geistliche Volkslieder, wobei der erwähnte Osterhymnus nun zwischen einem Fastnachts- und einem Weihnachtslied erklingt.
Schön, dass sich neues Liedschaffen auch an neuen Texten entzündet: So sind im Auftrag des Festivals tuns contemporans zwei neue Lieder entstanden. Astrid Alexandre arbeitete dafür mit Laura Livers und Gianna Olinda Cadonau zusammen. Über diese Anfrage habe sie sich gleich dreifach gefreut: «Per l’ina: Jau hai gugent punts!» («Zum einen mag ich Brücken.») Wenn ein Festival für zeitgenössische Musik Stücke von einer Singer/Songwriterin spielen möchte, sei das eine schöne Brücke: «eine Lektion für alle, die Musik immer noch ‹en truclets› / in Schubladen stecken möchten».
«Per l’autra: Ella exista, la lirica rumantscha feminina e moderna!» («Zum anderen: Es gibt sie, die weibliche und moderne rätoromanische Lyrik!») «Die Gedichte von Gianna Olinda Cadonau berühren mich.» Schon lange wollte Alexandre einige davon vertonen. «Wie immer, wenn mich ein Text inspiriert, stellte sich heraus: Die Musik versteckte sich schon zwischen den Zeilen / la musica è gia zuppada tranter las lingias!»
«Per finir: Era en il sectur da la musica classica contemporana vegnan anc adina sunadas dapli ovras dad umens che da dunnas.» («Zum Schluss: Auch in der Neuen Musik werden immer noch deutlich weniger Kompositionen von Frauen als von Männern aufgeführt.») Mit Laura Livers und Gianna Olinda Cadonau zwei neue Stücke zu schreiben, empfinde ich als eine Art melodiöses und trotzdem provokantes Winken mit dem Zaunpfahl: «Hey mund! Noss sains n’ans disturban en cas betg per scriver!” («Hey, Welt! Unsere Brüste sind uns beim Schreiben nicht im Weg!»)
 Jaap Achterberg
Jaap Achterberg
 Daniela Argentino
Daniela Argentino
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Ivo Bärtsch
Ivo Bärtsch
 Mirjam Fässler
Mirjam Fässler
 Asya Fateyeva
Asya Fateyeva
 Fortunat Frölich
Fortunat Frölich
 Briony Langmead
Briony Langmead
 Andreas Neeser
Andreas Neeser
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elena Ralli
Elena Ralli
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Joey Tan
Joey Tan
 Myriam Thyes
Myriam Thyes
 Peter Wendl
Peter Wendl
 Alfred Zimmerlin
Alfred Zimmerlin
 Maja Zimmerlin
Maja Zimmerlin
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Caterina di Cecca
Caterina di Cecca
 Areum Lee
Areum Lee
 Gergely Madaras
Gergely Madaras
 Patricia Martinez
Patricia Martinez
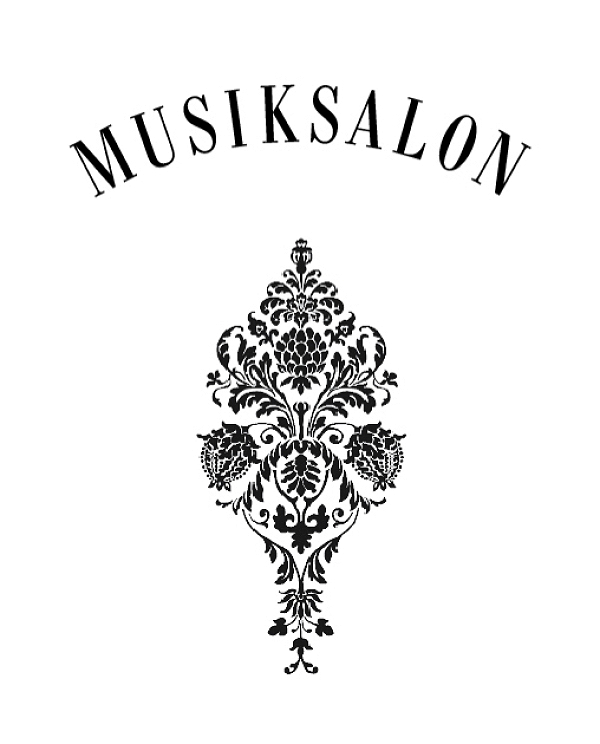 Martina Mutzner
Martina Mutzner
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Maxim Rysanov
Maxim Rysanov
 Clau Scherrer
Clau Scherrer
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Mario Venzago
Mario Venzago
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Ensemble Vocal Origen
Ensemble Vocal Origen
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
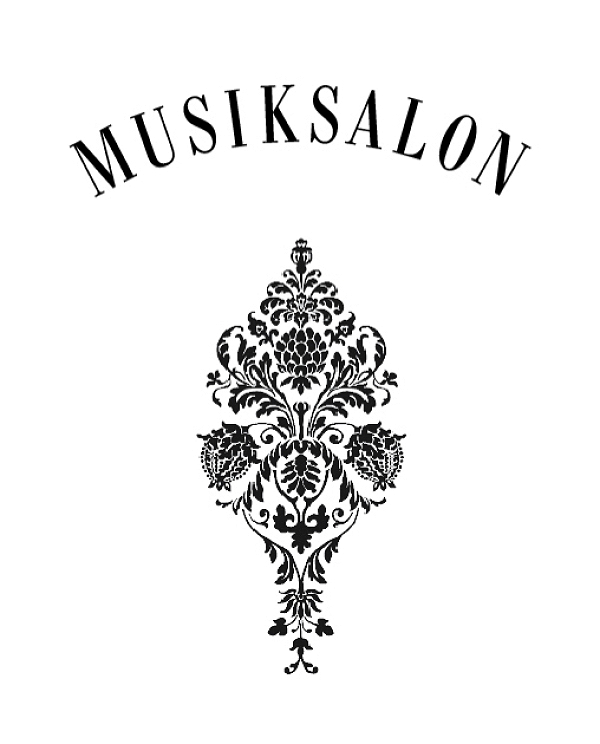 Musiksalon Chur
Musiksalon Chur
 Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Sebastian Bohren
Sebastian Bohren
 Baldur Brönnimann
Baldur Brönnimann
 Duri Collenberg
Duri Collenberg
 Martin Derungs
Martin Derungs
 Sara Bigna Janett
Sara Bigna Janett
 Vera Ivanova
Vera Ivanova
 Katrin Klose
Katrin Klose
 Magnus Lindberg
Magnus Lindberg
 Karolina Öhman
Karolina Öhman
 Elizaveta Parfentyeva
Elizaveta Parfentyeva
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elnaz Seyedi
Elnaz Seyedi
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Irina Ungureanu
Irina Ungureanu
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Fathom String Trio
Fathom String Trio
 Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
 Andrea Wiesli
Andrea Wiesli
 Muriel Schwarz
Muriel Schwarz
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Riccarda Caflisch
Riccarda Caflisch
 Manfred Spitaler
Manfred Spitaler
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
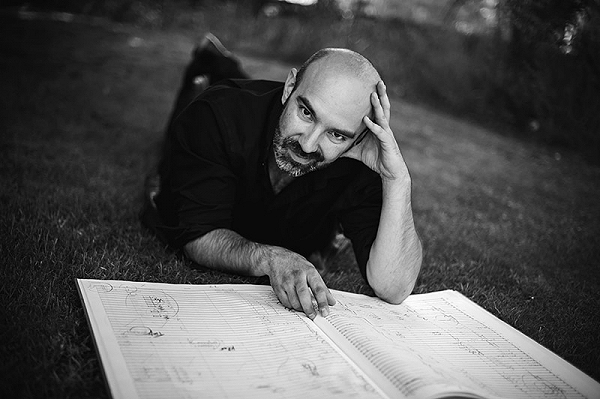 Facundo Agudin
Facundo Agudin
 Christian Hieronymi
Christian Hieronymi
 Asia Ahmetjanova
Asia Ahmetjanova
 Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021
Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021