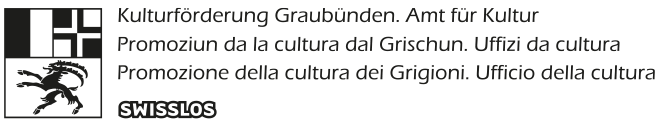Konzert 5
Energie ↑
Zu den faszinierendsten Aspekten des Erzählens gehört, dass sich eine Geschichte in der Erinnerung verschiedener Personen unterschiedlich abbildet. Bücher und Filme (etwa Akira Kurosawas «Rashomon») spielen damit und erzählen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven – wobei sich die «Wahrheit» jedes Mal anders ausnimmt. Gerade die Frage danach, was «wirklich» passierte, ist nun die Idee der Komposition «Fragmente der Erinnerung» von 2015. Der Ausgangspunkt, so schreibt die Komponistin Elnaz Seyedi, «ist eine musikalisch dichte Situation, die im Stück wieder und wieder in verschiedenen Konstellationen von Instrumenten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Dabei ändert sich jeweils der Fokus auf die unterschiedlichen Materialien. Feinheiten werden unter die Lupe genommen und bekommen Raum und Zeit zu ihrer Entfaltung. Diese öffnet neue Fenster, bringt neue formale Gestalten hervor und entfernt das jeweilige Erzählungsfragment von der ursprünglichen Situation.»
Ein Titel wie «Corrente» erstaunt bei Magnus Lindberg kaum. Weniger an einen barocken Tanz denkt man dabei allerdings als an ein zügig vorwärtstreibendes Stück und gleichzeitig an etwas, das unter Strom (so das italienische Corrente) ist. Lindbergs Musik ist stets energievoll und hochaufgeladen.
Schwere Quinten eröffnen das Stück, und bald schon kommt es in Fahrt. Das Lineare des Flusses ist prägend. Als Grundmaterial dienen denn auch rhythmische Loops unterschiedlicher Grösse, die einander überlagern, vom einen zum andern modulieren und fort eilen. So verändert sich das Stück ständig. Immerhin erscheint in der Mitte, in einem ruhigeren Moment, eine flüchtige Anspielung auf Henry Purcells «Funeral Music For Queen Mary» – aber nein, neobarock ist das Stück nicht, eher neoklassizistisch, wie Lindberg meinte und darin «eine gewisse Reinheit, besonders im sonoren Bereich» entdeckte.
In ganz andere, sehr aktuelle Welten führt uns Duri Collenberg; der Titel «Kaufzwangzwang» deutet es an. Der Komponist schreibt dazu: «Entscheidungsfreiheit im Kaufverhalten ist gegeben durch das, was angeboten wird. Sobald ein Kauf im World Wide Web stattfindet, ist das Prinzip von Entscheidungsfreiheit insofern eine Illusion, als dass hinter den Kulissen ein Algorithmus das Bereitstellen des Angebots lenkt. Er nährt sich durch das Gewählte und bestimmt dadurch das Spektrum der nachfolgenden Möglichkeiten. Indem wir wählen, generieren wir die künftige Auswahl. Das Stück ‹Kaufzwangzwang› – bzw. eine Art ihm zu Grunde liegender Algorithmus – zwingt einzelne Spieler*innen Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf die Entscheidungsfreiheit aller übrigen Spieler*innen haben. Alle Spieler*innen inklusive Dirigent*in spielen von einem Tablet, die Einzelstimmen sind über ein lokales Netzwerk miteinander verbunden. Während der erste Teil (I & Kaufzwang 1) als Anfang gesetzt ist, sind die übrigen Teile (II, III & Kaufzwang 2, IV) als Module zu verstehen, deren Reihenfolge erst während der Aufführung des Stücks bestimmt wird. Wer bei ‹Kaufzwangzwang› mitmacht, ist Spieler*in im doppelten Sinne. Die Musiker*innen ‹spielen› ein Stück, indem sie sich mit dessen Spielregeln einverstanden erklären. Dies bedeutet, dass man bereit ist, alle Positionen in einer Kausalkette einzunehmen. Man bestimmt durch das Auswählen die künftige Auswahl. Man übt als Gezwungene*r einen Zwang auf Mitspielende aus. Dies ist der Mechanismus, der den Algorithmus zu einer sich selbst erhaltenden Instanz macht. Er ist das Protokoll der Entscheidungen. Ein teils auskomponiertes, teils pseudoimprovisiertes Musikstück als Analogie zu personalisierter Internetwerbung … Kaufzwangzwang.»
Der Basler Martin Jaggi, der heute in Singapur lebt und unterrichtet, hat sich in seinen Werken immer wieder mit aussereuropäischer Musik auseinandergesetzt – und dabei eine Art imaginärer Volksmusik geschaffen. Aber exotisierend und vielleicht gar kitschig darf man sich das nicht vorstellen. Seine Musik geht einen Schritt zurück, in die unbewussten Regionen der musikalischen Erinnerung, zu Klängen, die uns roh und ungeschliffen vorkommen mögen, die aber gerade dadurch eine eigentümliche Kraft entfalten. «Enga» etwa bezieht sich auf einen indonesischen Klagegesang, der zunächst nur fragmentarisch anklingt und sich dann stetig beschleunigt. Die Musik ist von ausserordentlicher Beharrlichkeit.
Das führt uns fast unmittelbar weiter zu einem der berühmtesten Stücke der Musikgeschichte: zum «Bolero» von Maurice Ravel. Es ist ein Stück, das die Idee, etwas Gleiches aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, auf die
Spitze treibt. Von da her bietet sich der Vergleich mit Elnaz Seyedis Stück an. Im «Bolero» wird eine Melodie mit jedem Durchlauf auf neue Weise instrumentiert, entfaltet dabei stets andere Aspekte und steigert sich. Schon vor einigen Jahren arrangierte David Sontòn Caflisch das Stück für eine Quintettbesetzung. Wofür Ravel ein volles Orchester zur Verfügung stand, muss er reduzieren und mit weniger Klangmaterial eine ähnliche Wirkung erreichen. Ein herausfordernder Balanceakt! — Thomas Meyer
 Jaap Achterberg
Jaap Achterberg
 Daniela Argentino
Daniela Argentino
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Ivo Bärtsch
Ivo Bärtsch
 Mirjam Fässler
Mirjam Fässler
 Asya Fateyeva
Asya Fateyeva
 Fortunat Frölich
Fortunat Frölich
 Briony Langmead
Briony Langmead
 Andreas Neeser
Andreas Neeser
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elena Ralli
Elena Ralli
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Joey Tan
Joey Tan
 Myriam Thyes
Myriam Thyes
 Peter Wendl
Peter Wendl
 Alfred Zimmerlin
Alfred Zimmerlin
 Maja Zimmerlin
Maja Zimmerlin
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Caterina di Cecca
Caterina di Cecca
 Areum Lee
Areum Lee
 Gergely Madaras
Gergely Madaras
 Patricia Martinez
Patricia Martinez
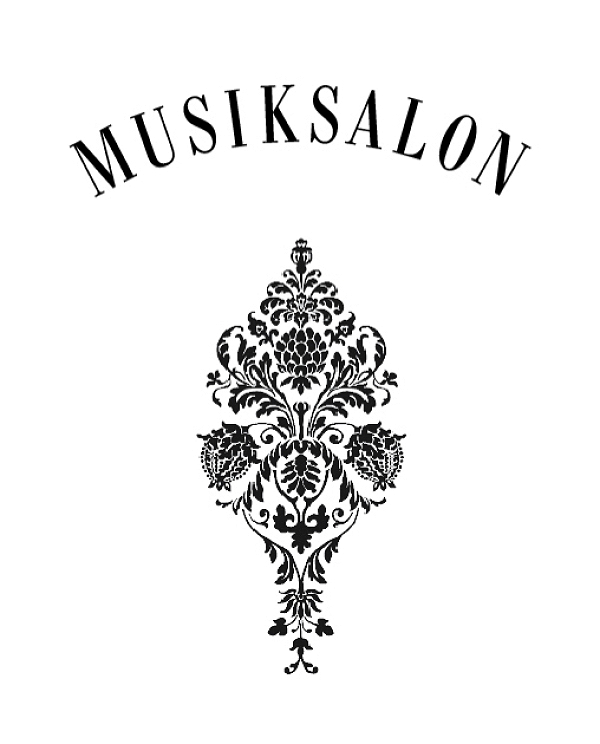 Martina Mutzner
Martina Mutzner
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Maxim Rysanov
Maxim Rysanov
 Clau Scherrer
Clau Scherrer
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Mario Venzago
Mario Venzago
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Ensemble Vocal Origen
Ensemble Vocal Origen
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
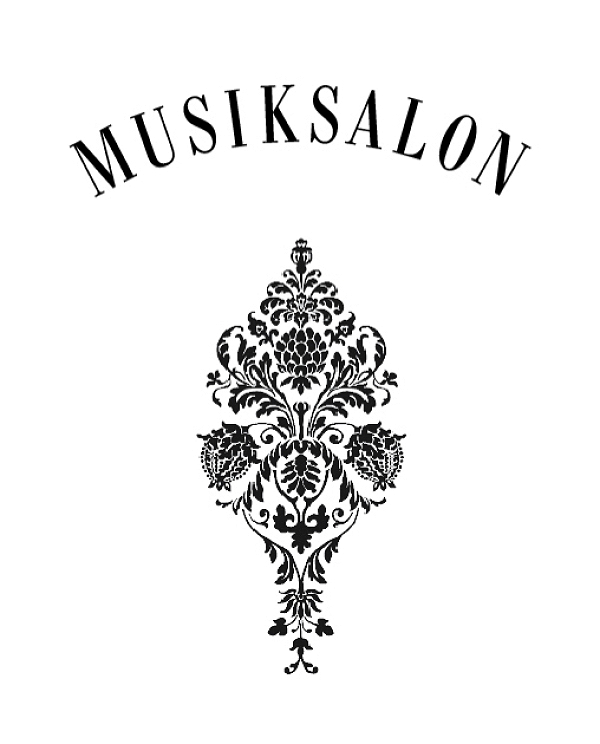 Musiksalon Chur
Musiksalon Chur
 Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Sebastian Bohren
Sebastian Bohren
 Baldur Brönnimann
Baldur Brönnimann
 Duri Collenberg
Duri Collenberg
 Martin Derungs
Martin Derungs
 Sara Bigna Janett
Sara Bigna Janett
 Vera Ivanova
Vera Ivanova
 Katrin Klose
Katrin Klose
 Magnus Lindberg
Magnus Lindberg
 Karolina Öhman
Karolina Öhman
 Elizaveta Parfentyeva
Elizaveta Parfentyeva
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elnaz Seyedi
Elnaz Seyedi
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Irina Ungureanu
Irina Ungureanu
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Fathom String Trio
Fathom String Trio
 Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
 Andrea Wiesli
Andrea Wiesli
 Muriel Schwarz
Muriel Schwarz
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Riccarda Caflisch
Riccarda Caflisch
 Manfred Spitaler
Manfred Spitaler
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
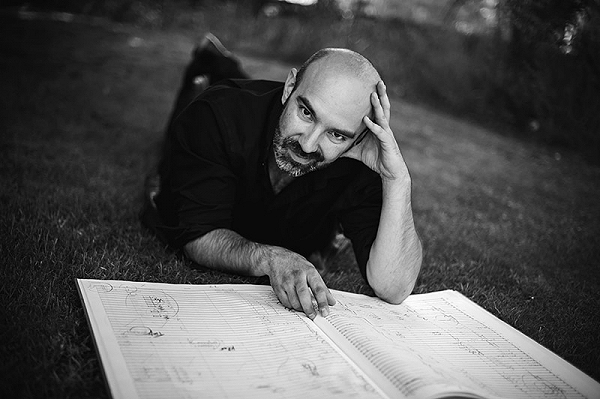 Facundo Agudin
Facundo Agudin
 Christian Hieronymi
Christian Hieronymi
 Asia Ahmetjanova
Asia Ahmetjanova
 Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021
Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021