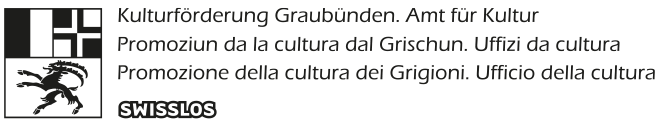Konzert 1
Magie des Klangs ↑
Der Titel klingt ungewöhnlich: «Isopor Oss». Die Heilpflanze Ysop klingt darin an, die einst zum Reinigen und Waschen verwendet wurden; ebenso erinnert «Oss» an Knochen. «Ich werde die Knochen reinigen», könnte das etwa bedeuten, reichlich archaisch und/oder surreal. David Sontòn Caflisch hat diesen Titel allerdings wie auch das vertonte Gedicht auf ungewöhnliche Weise gefunden bzw. neu erfunden. Er nahm ein romanisches Gedicht und verdrehte die Buchstaben jedes Verses, so dass aus den Anagrammen ein neuer, wiederum romanischer Text entstand. Was ursprünglich von Nebelschwaden über Wiesengründen sprach, geriet in Alptraumartige und entwickelte unheimliche Facetten – als klinge da etwas von ferne herüber, aus tiefer psychischer Schicht. «Dann / löse ich auf / das Salz / und mich selbst. / Niemand / gibt acht, / das Salz / ist draussen: / lach´ / Prinzessin.» So lautet zum Beispiel die dritte Strophe, die zum Zentrum des Werks wird: Hier bricht die Sopranstimme in ein strahlendes Forte aus. Die fünf Strophen sind in neun Teile aufgegliedert, in denen auch der Titel mehrmals vertont erscheint. Mit jedem Teil wechseln Gestus und Singweise. Am Schluss dreht die Stimme die bedeutungsvoll-sinnlosen Worte «Nunu Regi Aruani» – wie eine beschwörende Zauberformel.
«Lieux retrouvés» – wiedergefundene Orte: Im Titel schwingt bei Thomas Adès unweigerlich etwas von der Proustschen Erinnerung mit. Und tatsächlich ist die Erinnerung ein zentrales Motiv in vielen Kompositionen des Festivals. Der englische Komponist hat sich häufig auf französische Musik, besonders Barockmusik bezogen. So überrascht der Titel dieses Minicellokonzerts (ursprünglich ein Duo) nicht. Es ist eine sehr bildhafte Musik: Mit einer ruhig fliessenden Solokantilene in glitzernden Akkordbrechungen beginnen «Les eaux», sie geraten in heftige Bewegung, sinken ab und kehren zurück.
Im Tempo einer Promenade ist «La montagne» zu spielen. Wir folgen Bergsteigern auf ihrer Wanderung und kommen im Trioteil sogar zu Jodlern. Ruhig liegen die Felder in der Nacht («Les champs»). Am Ende jedoch steht «La ville – cancan macabre», wo wir ins Nachtleben geraten und Offenbachs Can-can begegnen. Hier verschmelzen Grotesk-Diabolisches, Makabres und virtuose Brillanz.
In ihrem Orchesterstück von 2016/17 bezieht sich die deutsche Komponistin Katrin Klose auf den 1998 verstorbenen Gérard Grisey, eine Hauptfigur der Spektralisten. Und der Titel «Accord» verweist auf eine der wichtigsten Leistungen dieser französischen Musikergruppe: Sie untersuchten das Obertonspektrum der Klänge und Harmonien und erprobten andere, nicht temperierte Stimmungen. All das steckt im Wort «Akkord». Die zentrale musikalische Gestalt ihres Stücks, so Klose, ist denn auch «der Gegensatz zwischen einem permanenten Abgleiten oder Entgleiten von der temperierten Tonhöhe hin zu Zwischentönen bzw. auch zum nächsten Klang in einer formbildenden Akkordprogression. Das Xylophon nimmt zusammen mit Oboe und Fagott die Rolle einer quasi Stimmgabel ein, die nur auf temperierter Tonhöhe zum Einsatz kommt. Hinzu kommt in Anlehnung an eine Idee von Gérard Grisey eine Schicht von ‹herbes folles›, von Unkraut, das die klare Struktur überwuchert und schliesslich in einem Zwischenteil die Führung übernimmt, bevor es im Schlussteil komplett verschwindet und den Blick freigibt auf den reinen Klang.»
In seinem ersten Violinkonzert bezog sich Magnus Lindberg 2006 auf Mozart zu dessen 250. Geburtstag – allerdings nur in der Orchesterbesetzung. Das erstaunt, wenn man den üppigen Sound hört, und zeigt, was für ein grandioser Orchestrator der Finne ist. Allein, indem er die Streicher teilt, erzeugt er einen dichteren Klang. Im übrigen ist das Werk eher seinem Vorbild Sibelius nahe. Allein die Eröffnungskantilene der Violine erinnert an dessen Violinkonzert. Es klingt auch, wie Kommentatoren sofort feststellten, «überraschend tonal für Lindberg» – ein Punkt, der ihm bald viel Kritik einbrachte. Aber es zeugt auch von der Wandlungsfähigkeit des Finnen.
Auch Virtuosität gehört dazu, durchaus im klassisch-romantischen Sinn. Lindberg schöpft da sämtliche instrumentalen Möglichkeiten aus. Höhepunkt des Werks ist denn auch die Solokadenz am Ende des zweiten Satzes, die ins Finale überleitet. Die Sologeige ist gleichsam der Joker, der mehrere Rollen übernimmt.
Die Dreisätzigkeit des Werks erinnert an die klassische Konzertform, aber diese formale Strenge wird durch Übergänge aufgeweicht und ist hier vielfältig ausgestaltet. Gewiss folgt die Abfolge der Konzertpsychologie: Zunächst wird das Material exponiert und verarbeitet; im langsamen Satz darf das Soloinstrument seine Expressivität unter Beweis stellen; am Schluss steht eine rhythmisch akzentuierte Stretta. Aber Lindberg schafft darin eine grössere Einheit, indem er mehrere «Themen» über alle Sätze verteilt – und sie dabei jedes Mal in einem anderen Licht erscheinen lässt. So setzt er gleichsam Leuchttürme auf diesen Weg, die dem Ohr eine Orientierung geben. Gleichzeitig ist dieser Weg aber so wendungsreich, dass er immer wieder überrascht.
 Jaap Achterberg
Jaap Achterberg
 Daniela Argentino
Daniela Argentino
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Ivo Bärtsch
Ivo Bärtsch
 Mirjam Fässler
Mirjam Fässler
 Asya Fateyeva
Asya Fateyeva
 Fortunat Frölich
Fortunat Frölich
 Briony Langmead
Briony Langmead
 Andreas Neeser
Andreas Neeser
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elena Ralli
Elena Ralli
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Joey Tan
Joey Tan
 Myriam Thyes
Myriam Thyes
 Peter Wendl
Peter Wendl
 Alfred Zimmerlin
Alfred Zimmerlin
 Maja Zimmerlin
Maja Zimmerlin
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Caterina di Cecca
Caterina di Cecca
 Areum Lee
Areum Lee
 Gergely Madaras
Gergely Madaras
 Patricia Martinez
Patricia Martinez
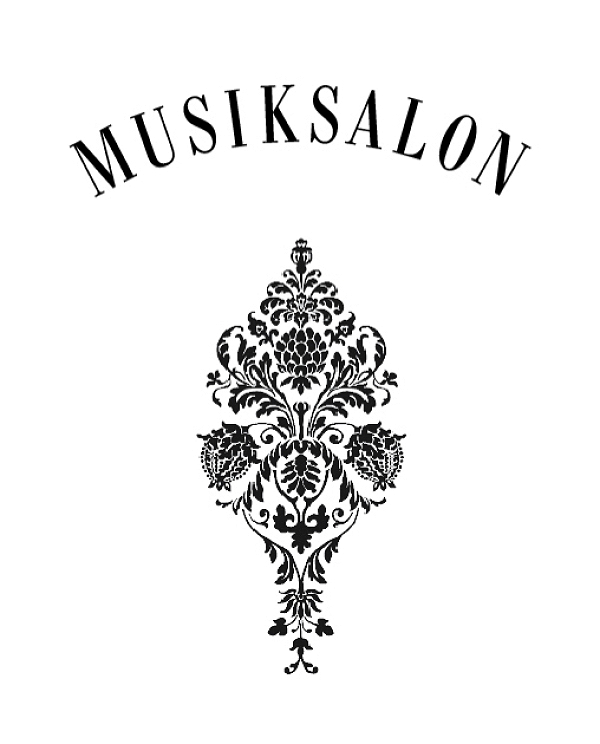 Martina Mutzner
Martina Mutzner
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Maxim Rysanov
Maxim Rysanov
 Clau Scherrer
Clau Scherrer
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Mario Venzago
Mario Venzago
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Ensemble Vocal Origen
Ensemble Vocal Origen
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
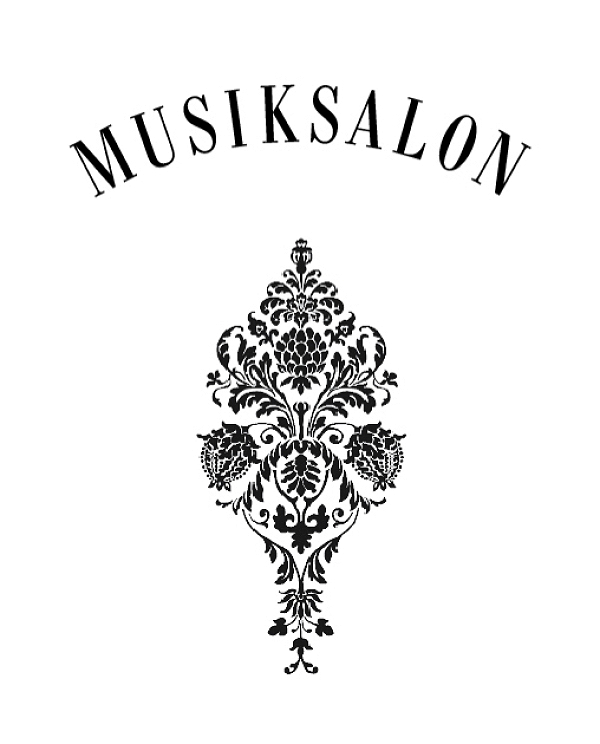 Musiksalon Chur
Musiksalon Chur
 Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Sebastian Bohren
Sebastian Bohren
 Baldur Brönnimann
Baldur Brönnimann
 Duri Collenberg
Duri Collenberg
 Martin Derungs
Martin Derungs
 Sara Bigna Janett
Sara Bigna Janett
 Vera Ivanova
Vera Ivanova
 Katrin Klose
Katrin Klose
 Magnus Lindberg
Magnus Lindberg
 Karolina Öhman
Karolina Öhman
 Elizaveta Parfentyeva
Elizaveta Parfentyeva
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elnaz Seyedi
Elnaz Seyedi
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Irina Ungureanu
Irina Ungureanu
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Fathom String Trio
Fathom String Trio
 Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
 Andrea Wiesli
Andrea Wiesli
 Muriel Schwarz
Muriel Schwarz
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Riccarda Caflisch
Riccarda Caflisch
 Manfred Spitaler
Manfred Spitaler
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
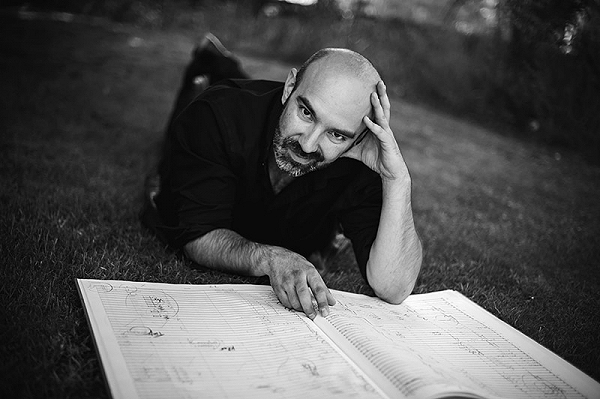 Facundo Agudin
Facundo Agudin
 Christian Hieronymi
Christian Hieronymi
 Asia Ahmetjanova
Asia Ahmetjanova
 Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021
Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021