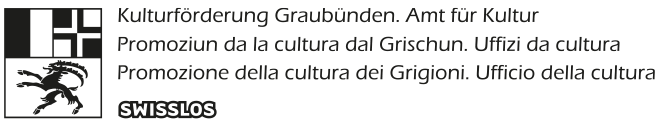Konzert 3
In Bewegung ↑
Als sie 2008/9 nach Hongkong und Guangzhou reiste, fühlte sich die südkoreanische, heute in Berlin lebende Komponistin Unsuk Chin in ihre Kindheit zurückversetzt. Die armseligen Quartiere der Städte, unweit der modernen Zentren mit ihrer glitzernden Konsumwelt gelegen, erinnerte sie an die 60er Jahre in Seoul, als Südkorea noch von Armut und Diktatur geprägt war und die industrielle Modernisierung erst bevorstand. «Als Kind habe ich», so sagt sie, «insbesondere eine Unterhaltungstruppe immer wieder erlebt. Diese Laienmusiker und -schauspieler tingelten von Dorf zu Dorf, um den Leuten selbst hergestellte Medikamente, die bestenfalls wirkungslos waren, anzudrehen. Um die Menschen zu locken, führte man Theater mit Gesang, Tanz und diversen Kunststücken auf…» Dieses Strassentheater steht im Zentrum von «Gougalōn».
Unsuk Chin, die schon immer eine Neigung zum surrealen Charme des Abseitig-Alltäglichen, etwa zu Graffiti, hatte, verleiht dieser «imaginierten Volksmusik» ein raffiniert schräges Gewand. Subtil etwa ist das Spiel zwischen Flaschen und Dosen, und der Gesang der kahlen Sängerin (das Absurde Theater eines Eugène Ionesco lässt grüssen) wird nicht zur schrillen Groteske, sondern erlangt eine wunderbar morbide Eleganz. Nichts ist, wie es scheint, und von da her ist auch der Titel zu verstehen: Das althochdeutsche Wort «Gougalōn» bedeutet soviel wie «vorgaukeln», «vortäuschen» oder «Wahrsagerei betreiben».
Nicht vergessen ist damit, dass hinter diesen skurrilen Szenen mit seiner fernöstlich geschärften Farbigkeit auch die sozialen Gegensätze hineinwirken.
Bildhaftigkeit und Erinnerung spielt auch bei der Russin Vera Ivanova eine Rolle, die heute an der Chapman University in Kalifornien arbeitet und lehrt. Im Gegensatz zu Unsuk Chins Werk handelt es sich hier um abstrakte und statische Bilder, eben «Still Images», die auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind. Statisch sind sie, weil sie sich, obwohl im Innern bewegt und agil, kaum entwickeln. Immer wieder kippt das Stück zum Ausgangspunkt, einem fein umspielten Zentralton, zurück. Der Titel «Still Images of the Restless Mind» umschreibt das Stück vielleicht noch treffender: So hiess die erste Kammerorchesterfassung des Stücks von 2006. Die Musik reflektiere einen Gemütszustand, wie wenn wichtige persönliche Bilder aus der Kindheitserinnerung in einen vom Alltag verwirrten Geist zurückkehren. Die Bilder wirken unverbunden und beziehen sich insgeheim doch aufeinander.
«Changements» nennt der Bündner Martin Derungs, einst Schüler von Benedikt Dolf, sein Stück, und er möchte das durchaus wörtlich verstanden wissen, als allmählich sich verändernde Textur. Die Musik ist äusserst sparsam gehalten, die Elemente und Passagen werden eher in den Klangraum gestellt, sie bleiben einander heterogene. Nur momenteweise entwickelt sich etwas. Schliesslich entdichtet sich der Klang noch mehr. Zurück bleiben einzelne, lose nebeneinandergesetzte Linien im Raum.
«Arena II» von Magnus Lindberg geht auf ein älteres Stück namens «Arena» von 1995 zurück und reduziert das Sinfonieorchester auf sechzehn Instrumente. Flirrende Flächen, darüber ein markiges Terzmotiv: dieser Gegensatz von undeutlichem Vibrieren und klaren Tonfolgen bildet die Ausgangslage, aus der sich viele und weite Variationen entwickeln, durchaus schön, gelegentlich pulsierend und dramatisch – und erinnernd an die grossen sinfonischen Vorläufer, gerade auch Sibelius. Die Motive sind da nicht nur Ankerpunkte für das Hören, sie gestalten sich ständig um und führen das Ohr weiter.
 Jaap Achterberg
Jaap Achterberg
 Daniela Argentino
Daniela Argentino
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Ivo Bärtsch
Ivo Bärtsch
 Mirjam Fässler
Mirjam Fässler
 Asya Fateyeva
Asya Fateyeva
 Fortunat Frölich
Fortunat Frölich
 Briony Langmead
Briony Langmead
 Andreas Neeser
Andreas Neeser
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elena Ralli
Elena Ralli
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Joey Tan
Joey Tan
 Myriam Thyes
Myriam Thyes
 Peter Wendl
Peter Wendl
 Alfred Zimmerlin
Alfred Zimmerlin
 Maja Zimmerlin
Maja Zimmerlin
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
Zuhören Schweiz
Titel
Atmosphères
Eröffnungskonzert ö!
Konzert Kaphi
Konzert OSI
Konzert ö! und Kaphi
Konzert Origen
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Caterina di Cecca
Caterina di Cecca
 Areum Lee
Areum Lee
 Gergely Madaras
Gergely Madaras
 Patricia Martinez
Patricia Martinez
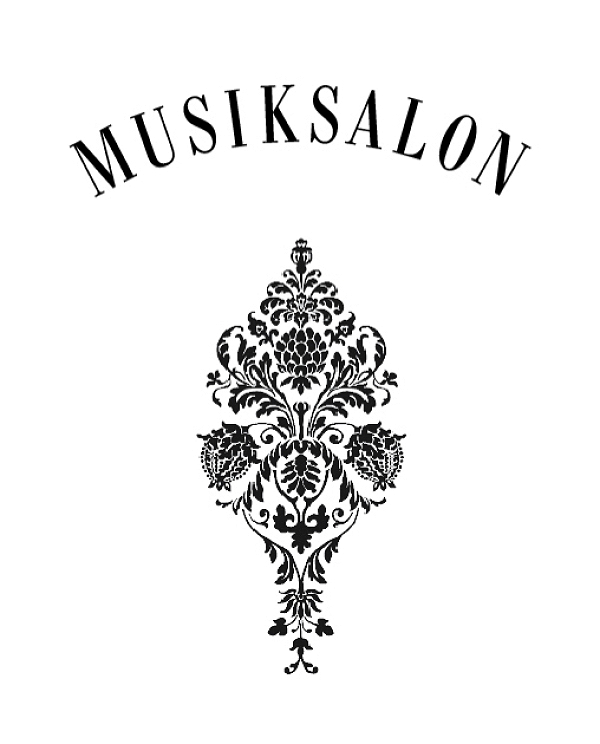 Martina Mutzner
Martina Mutzner
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Maxim Rysanov
Maxim Rysanov
 Clau Scherrer
Clau Scherrer
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Mario Venzago
Mario Venzago
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Ensemble Vocal Origen
Ensemble Vocal Origen
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
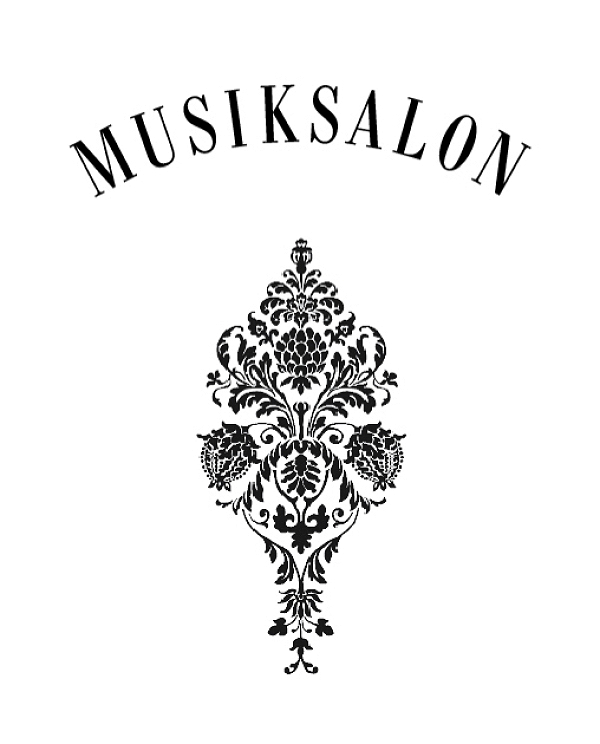 Musiksalon Chur
Musiksalon Chur
 Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
Orchestra della Svizzera italiana
Programmheft
Eröffnungskonzert
Apartment House
Grosses Ensemble
Liedermatinée
Komponist*innengespräch
Abschlusskonzert
Eröffnungskonzert Detail
Grosses Ensemble Detail
Liedermatinée Detail
Abschlusskonzert Detail
 Philippe Bach
Philippe Bach
 Sebastian Bohren
Sebastian Bohren
 Baldur Brönnimann
Baldur Brönnimann
 Duri Collenberg
Duri Collenberg
 Martin Derungs
Martin Derungs
 Sara Bigna Janett
Sara Bigna Janett
 Vera Ivanova
Vera Ivanova
 Katrin Klose
Katrin Klose
 Magnus Lindberg
Magnus Lindberg
 Karolina Öhman
Karolina Öhman
 Elizaveta Parfentyeva
Elizaveta Parfentyeva
 Francesc Prat
Francesc Prat
 Elnaz Seyedi
Elnaz Seyedi
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
 Irina Ungureanu
Irina Ungureanu
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
Kammerphilharmonie Graubünden
Ursprung
Nachlass Stundung
Dürrenmatt-Zyklus
Liederzyklus Gion Antoni Derungs
Komponistengespräch
Sinfoniekonzert
Ursprung Details
Nachlass Stundung Details
Dürrenmatt Zyklus Details
Liedermatinee Details
Synfoniekonzert Details
Formationen 2019
 Ensemble ö!
Ensemble ö!
 Kammerphilharmonie Graubünden
Kammerphilharmonie Graubünden
 Fathom String Trio
Fathom String Trio
 Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
Orchestre Musique des Lumières
Mitwirkende 2019
Irina Ungureau 2019
 Andrea Wiesli
Andrea Wiesli
 Muriel Schwarz
Muriel Schwarz
 Simone Zgraggen
Simone Zgraggen
 Riccarda Caflisch
Riccarda Caflisch
 Manfred Spitaler
Manfred Spitaler
 David Sontòn Caflisch
David Sontòn Caflisch
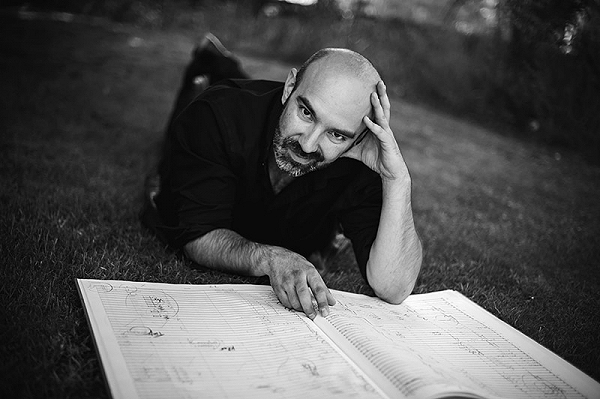 Facundo Agudin
Facundo Agudin
 Christian Hieronymi
Christian Hieronymi
 Asia Ahmetjanova
Asia Ahmetjanova
 Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021
Philippe Bach 2019
Home
Atmosphères
Call for Scores
Über uns
Informationen
Tickets 2025
Tickets 2023
Tickets 2021
Tickets 2019
Aufnahmen
Medien
Kontakt
Impressum
Livestream 2021